Vom Menschen ausgestoßene Emissionen bedrohen das atmosphärische Gleichgewicht der verschiedenen Gase. Sogenannte Treibhausgase verursachen den Anstieg der globalen Temperatur. Bei den internationalen Klimaverhandlungen spricht man inzwischen von sieben verschiedenen relevanten Treibhausgasen: Kohlendioxid (CH2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) und verschiedene Fluorchlorkohlenwasserstoffe (wasserstoffhaltige Fluorkohlenwasserstoffe (HFKW)), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW), Schwefelhexafluorid (SF6), Stickstofftrifluorid (NF3). Nicht jedes Treibhausgas hat die gleiche Erwärmungswirkung. Ein Kilogramm Methan trägt zum Beispiel 28-mal so stark zum Treibhauseffekt bei wie ein Kilogramm Kohlendioxid. Deshalb wird mit Hilfe des sogenannten Treibhauspotentials oder auch CO2 -Äquivalent die Erwärmungswirkung normiert. CO2 ist das Treibhausgas, das am meisten vom Menschen verursacht und ausgestoßen wird. Deshalb wird oft nur vom CO2 -Fußabdruck gesprochen, obwohl auch andere Treibhausgase ausgestoßen werden. In einer CO2 -Bilanz werden neben Kohlendioxid oft auch andere Treibhausgase bilanziert und in der Einheit Tonnen CO2 -Äquivalent (CO2 e) angegeben.
Der freiwillige Ausgleich bietet Unternehmen, Institutionen aber auch Privatpersonen eine Möglichkeit, sich am Klimaschutz zu beteiligen und gleichzeitig Entwicklung zu fördern. Das Prinzip des Ausgleichs beruht auf der Überlegung, dass es für das Klima nicht entscheidend ist, an welcher Stelle Treibhausgase vermieden oder reduziert werden. Bei dem Ausgleich werden daher Treibhausgasemissionen, die an einem Ort verursacht werden, in gleicher Höhe an anderer Stelle durch die Finanzierung von Klimaschutzprojekten eingespart. Der Ausgleich von Emissionen sollte allerdings ausschließlich als zusätzliche Maßnahmen zu ambitionierten eigenen Reduktionsmaßnahmen angewendet werden.
Entscheidend für das Instrument des Ausgleichs ist, dass die Klimaschutzleistung des Projektes im globalen Süden ohne den Verkauf zertifizierter Emissionsreduktionen nicht stattgefunden hätte. Der Ausgleich von Treibhausgasen erfolgt also zusätzlich.
Der freiwillige Ausgleich von Treibhausgasen bietet Ihnen als Unternehmen, Institution oder Privatperson eine Möglichkeit, nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz zu fördern. Der CO2 -Ausgleich erfolgt durch die Finanzierung von Projekten in Ländern des Globalen Südens, die neben dem Klimaschutz auch die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort verbessern.
Zuerst sollten Sie sich einen Partner für Entwicklung und Klima (PEK) der Allianz für Entwicklung und Klima suchen. Unsere PEK unterstützen i.d.R auch bei der Erstellung der CO2 -Bilanz. Privatpersonen können ihr CO2 -Profil auch mit dem CO2 -Rechner des Umweltbundesamts (UBA) erstellen. Nach der Erstellung der CO2 -Bilanz können Sie über den von Ihnen ausgewählten PEK Ihre CO2 -Emissionen ausgleichen, indem Sie Emissionszertifikate im Umfang Ihrer gewünschten Ausgleichsmenge erwerben. Falls Sie einen umfangreichen Ausgleich planen, besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit Projektpartner:innen auch eigene, individuelle Projekte entwickeln und zertifizieren zu lassen.
Die Emissionszertifikate bescheinigen, dass Emissionen in derselben Höhe in Klimaschutzprojekten reduziert oder vermieden wurden. Viele dieser Projekte sind in Ländern des Globalen Südens angesiedelt. Dort fallen Emissionsminderungskosten pro Tonne CO2 häufig niedriger aus als in Industrieländern. Klimaschutzprojekte können dort neben einem wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz auch Beiträge zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen und zum technologischen Fortschritt leisten. Mit dem Zertifikatskauf werden beispielsweise Projekte zur Förderung erneuerbarer Energien oder zum Schutz von Wäldern finanziert. Anschließend müssen die Emissionszertifikate stillgelegt werden, um die Ausgleichsleistung sicherzustellen. Die Stilllegung erfolgt über die Partner:innen für Entwicklung und Klima. Der Stilllegungsnachweis für die erworbenen Emissionszertifikate dient dafür als Nachweis.
Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen ist bei der Anrechnung von Klimaschutzmaßnahmen für die eigene THG-Bilanz jedoch zu beachten, dass es zu keiner Doppelzählung von Emissionsreduktionen kommt. (Siehe Infosheet zu Corresponding Adjustment).
Der freiwillige Ausgleich von Treibhausgasen kann zugleich Klimaschutz und Entwicklung fördern (vgl. 1.5). Der Ausgleich von Treibhausgasen über Projekte in Ländern des Globalen Südens kann neben der positiven Klimawirkung u.a. auch die Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen vor Ort, die Gleichstellung fördern oder trägt beispielsweise zum Schutz der Biodiversität bei. Hochwertige Klimaschutzprojekte sind oft dadurch gekennzeichnet, dass sie einen besonderen Fokus auf positive Entwicklungswirkungen legen, die auch nachweislich zertifiziert sind. Somit tragen die Klimaschutzprojekte maßgeblich zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 bei.
Je mehr Emissionszertifikate aus hochwertigen Klimaschutzprojekten erworben werden, desto mehr CO2 -Emissionen werden eingespart und desto größer sind die Entwicklungswirkungen. Laut Umweltbundesamt ist das Volumen der verkauften und stillgelegten Zertifikate auf dem deutschen Kompensationsmarkt von 22,1 Millionen Tonnen CO2 Äq im Jahr 2017 auf 43,6 Millionen Tonnen CO2 Äq im Jahr 2020 angestiegen. Das stillgelegte Volumen hat sich seit 2016 versechsfacht. Eine Prognose für das Jahr 2021 bestätigt, dass der Trend sich fortsetzen wird.
Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima rät dringend dazu, keine minderwertigen Emissionszertifikate, d.h. in der Regel solche ohne den Nachweis einer Zertifizierung über einen hochwertigen Standard, zu nutzen.
Klimaschutzprojekte werden weltweit durchgeführt, die meisten Projekte sind in Ländern des Globalen Südens angesiedelt.
Zu den häufigsten Projekttypen zählen Erneuerbare Energie-, Energieeffizienz-, Landwirtschafts-, Wald und Forstwirtschaftsprojekte:
Die Finanzierung von diesen Klimaschutzprojekten trägt, neben den CO2 –Minderungseffekten, auch zum wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt bei und verbessert so die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort.
Der Zertifikatspreis für eine Tonne CO2 -Äquivalent variiert von Anbieter:in zu Anbieter:in. Die Höhe des Preises wird durch mehrere Faktoren beeinflusst. Dabei variieren die Kosten des Ausgleichs, je nach Aktivität, die zum Ausgleich von Emissionen unternommen wird, sowie nach Standort oder Größe des Projektes. Projekte unterscheiden sich auch darin, welche Wirkungen sie über die Minderungen von Treibhausgasen hinaus erzielen: manche Projekte reduzieren in erster Linie Treibhausgase, andere schaffen auch erheblichen Mehrwert, indem sie zum Beispiel die Luftverschmutzung reduzieren oder Einkommen für die ärmsten Bevölkerungsschichten generieren.
In der Stiftung liegt der Fokus auf Projekten mit vielfältigen positiven Wirkungen und einem Beitrag zur Entwicklung in Ländern des Globalen Südens. Weitere Einflussfaktoren sind das Alter der Zertifikate sowie die Höhe der Nachfrage nach bestimmten Projekttypen oder Standorten. Zudem kann das Volumen, das gekauft wird, den Preis für eine Tonne CO2 -Äquivalent beeinflussen. Außerdem ist der Preis eines Zertifikats auch abhängig von den Qualitätsanforderungen, die an dieses gestellt werden. Es gibt verschiedene Qualitätsstandards, die sicherstellen, dass bestimmte Qualitätskriterien erfüllt werden. Ein höherer Preis ist jedoch nicht grundsätzlich mit einer höheren Qualität gleichzusetzen.
Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima empfiehlt eine Abfrage der Kostentransparenz der Emissionszertifikate bei Ihrem Anbieter (PEK). Nur so lässt sich überprüfen, wieviel Ihres Klimaschutzbeitrags in den Projekten vor Ort ankommt.
Um auf dem freiwilligen Markt Projektqualität zu gewährleisten, haben sich verschiedene anbieterübergreifende Qualitätsstandards etabliert. Zu den gängigsten gehören unter anderem Gold Standard (GS), Verified Carbon Standard (VCS), Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBS), SOCIALCARBON, Fairtrade Climate Standard und Plan Vivo. Diese Standards garantieren, dass verschiedene Kriterien wie Transparenz, Zusätzlichkeit der Klimawirkungen und Permanenz eingehalten werden. Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima hat bereits einen Kriterienkatalog erarbeitet, der die gemeinsamen Anforderungen an die Entwicklungs- und Klimaschutzprojekte sowie die zugelassenen Standards definiert.
Gehobene Qualitätsstandards verbieten den Verkauf von Minderungen, bevor sie überhaupt eingetreten sind („ex-ante“), was jedoch für manche langfristige Projekte wie Aufforstung eine Einschränkung bedeuten kann. Ex-ante-Zertifizierungen sind in der Allianz für Entwicklung und Klima zugelassen, können jedoch nicht für Aussagen zum Umfang des erfolgten Ausgleichs oder für Aussagen in Richtung einer bereits erreichten „Klimaneutralität“ genutzt werden.
Eine allgemeine Risikoabschätzung von Projekttypen unter verschiedenen Standardzertifizierungen lässt sich unter dem kostenfreien Online-Tool der CCQI vornehmen.
Die Zertifikate auf dem Markt des freiwilligen Ausgleichs werden von privat-wirtschaftlichen und gemeinnützigen Anbietenden angeboten und frei gehandelt. Für die Klimawirkung ist entscheidend, dass Zertifikate nicht mehrfach verkauft werden können. Nur so ist sichergestellt, dass jede Ausgleichszahlung tatsächlich zur Emissionsminderungen beiträgt. Deswegen werden die Zertifikate „stillgelegt“, wenn sie für Ausgleichszwecke bereits genutzt wurden – sie können dann nicht noch einmal verkauft werden.
Um dies zu ermöglichen, müssen die ausgegebenen Zertifikate eines Projekts an zentraler Stelle registriert werden. Konkret vergeben entsprechende Register Seriennummern und verfolgen die Besitzverhältnisse der Emissionszertifikate. Die Information darüber, ob Zertifikate „stillgelegt“ wurden, ist meistens öffentlich zugänglich. Es gibt kein allgemeingültiges öffentliches Register für Zertifikate des freiwilligen Marktes. Vielmehr hat jeder Qualitätsstandard sein eigenes Register oder nutzt das Register eines Drittanbieters. Relevant sind insbesondere zwei Registerbetreiber, die APX und IHS Markit, die beiden größten Register im Bereich freiwilliger Emissionstransaktionen. Auch der Gold Standard und Verra betreiben eigene Register für ihre Zertifikate.
Bei der freiwilligen Kompensation gleichen Unternehmen, Institutionen oder Privatpersonen ihre verbliebenen Emissionen aus, ohne dazu verpflichtet zu sein. Ausgleichsansätze sind dennoch keineswegs als Ersatz zum ambitionierten Klimahandeln gedacht. Ambitionierte nationale Klimaziele zu setzen und einzuhalten, bleibt für die Regierungen weiterhin unabdingbar, um den Klimawandel zu bekämpfen. Auch Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen sollten in erster Linie bemüht sein, die durch ihre Tätigkeiten entstandenen Emissionen zu reduzieren. Doch nicht überall ist es möglich, Emissionen vollständig zu vermeiden oder zu reduzieren. In diesem Fall kommt ein Ausgleich durch Emissionsreduktionen an anderer Stelle in Betracht. So wird in den Unternehmen die Option der freiwilligen Kompensation meist zum Ausgleich dienstlicher Flüge, des CO2 -Fußabdrucks des gesamten Unternehmens oder einzelner Produkte genutzt. Jedoch sollten die Ausgleichsmöglichkeiten nicht als Anlass genommen werden, Bemühungen zur Emissionsvermeidung und -reduktion zu umgehen.
Klimaschutzprojekte werden weltweit durchgeführt, die meisten Projekte sind in Ländern des Globalen Südens angesiedelt. Hier können sie breite Wirkungen entfalten und neben Klimaschutz auch die Lebensbedingungen verbessern.
Anbieter:innen für Emissionszertifikate entwickeln eigene Klimaschutzprojekte und verkaufen die daraus erzeugten Zertifikate. Viele Anbieter:innen bedienen sich auch an dem bereits vorhandenen Markt, erwerben dort Zertifikate und bieten diese ihren Kund:innen an. Aktuell fungieren zahlreiche Flug- und Busgesellschaften, Reiseportale oder Druckereien als „Drittanbieter“ für Zertifikate: Sie bieten den Kunden an, die durch ihren Auftrag an die Firma entstandenen Emissionen auszugleichen und erwerben gegebenenfalls Zertifikate bei den Anbieter:innen freiwilliger Kompensation. Das kann in Form einer Zusatzoption bei der Bestellung oder bereits im Angebot einberechnet sein.
Mit den Einnahmen aus dem Verkauf von Zertifikaten werden unterschiedlichste Projekte finanziert. Hierzu zählt beispielsweise der Einsatz von erneuerbaren Energien oder energiesparenden Technologien, der Schutz von Wäldern oder die Renaturierung von Mooren. Zu den generellen Anforderungen, die die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima an Projekte stellt, zählt neben der Emissionsreduktion und den nachhaltigen Entwicklungswirkungen im Sinne der Agenda 2030 (SDGs), dass der Standort der Projekte in Ländern des Globalen Südens ist.
Wie viel Geld bei den Projekten ankommt, ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich. Seriöse Anbieter:innen berichten über ihre Einnahmen und ihre Ausgaben und weisen ihren Verwaltungsanteil aus. Bei der Auswahl Ihres Anbieters sollten Sie darauf achten, ob Informationen zur Verfügung gestellt werden, die Ihnen zeigen, zu welchem Anteil Ihr Geld in die Projekte und in die Verwaltung des Anbietenden fließt.
Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima setzt sich dafür ein, nachhaltige Entwicklung und globalen Klimaschutz über das Mittel des freiwilligen Ausgleichs zusammen zu bringen. Hervorgegangen aus der gleichnamigen Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) tritt die Stiftung an, zusätzliche Mittel für nachhaltige Entwicklung zu mobilisieren. Sie schärft das Bewusstsein für die große Wirkung, die der freiwillige Ausgleich zuletzt nicht vermeidbarer Treibhausgas-Emissionen über hochqualitative Klimaschutzprojekte in Ländern des Globalen Südens hat. Denn zusätzliche, freiwillige Ausgleichsbeiträge, die gleichermaßen der Entwicklungsförderung und dem Klimaschutz in Ländern des Globalen Südens dienen, leisten einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen und klimaverantwortlichen Transformation.
Die Stiftungszwecke sind:
Die Stiftung verfolgt mit ihren Aktivitäten und als Plattform darüber hinaus das Ziel, die Vernetzung und den fachlichen Austausch der Unterstützer:innen der Allianz untereinander voranzutreiben. Schlussendlich soll gesammeltes Know-how gebündelt und verbreitet werden, auch im internationalen Kontext.
Wie in den Zielen aufgeführt, möchte die Allianz den Fokus des Ausgleichs neben den Klimawirkungen auch auf die vielfältigen Entwicklungswirkungen von Projekten legen. Die Projekte sollen insbesondere auch dazu beitragen, die Ziele der UN-Entwicklungsagenda 2030 zu erreichen, indem sie die Lebensbedingungen der Menschen in Ländern des Globalen Südens verbessern. In dem erarbeiteten Kriterienkatalog sind die zugelassenen Standards und Projekte festgehalten.
Freiwillige Kompensation hat nicht nur ein positives Image. Dies hat mehrere Gründe:
Erstens wird der freiwillige Ausgleich bisweilen mit „Ablasshandel“ assoziiert oder als Nullsummenspiel verstanden. Eine mögliche Konsequenz des Ausgleichs könnte darin bestehen, dass auf individueller oder unternehmerischer Ebene sorgloser mit dem eigenen CO2 -Fußabdruck umgegangen werde. Gegen dieses Image sprechen Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Menschen, die kompensieren, sich auch insgesamt klimafreundlicher verhalten. Die Stiftung plädiert ausdrücklich dafür, dass Emissionen soweit möglich vermieden und reduziert werden, bevor die heute noch nicht vermeidbaren Emissionen ausgeglichen werden. Ausgleichszahlungen sollen somit keineswegs als „Freibrief“ verstanden werden, sondern vielmehr als eine zusätzliche Möglichkeit, einen Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 zu leisten und das Klima zu schützen. Die im Rahmen der Allianz für Entwicklung und Klima unterstützten Klimaschutzprojekte in Ländern des globalen Südens fördern zusätzliches, freiwilliges Engagement aus dem Privatsektor, von Institutionen, Vereinen, Verbänden, Kommunen und Verwaltungen und Privatpersonen. Minderungsverpflichtungen, etwa aus dem Europäischen Emissionshandelssystem (EU-ETS) sowie nationale Emissionsminderungsziele, sind davon vollkommen unberührt und bleiben bestehen.
Zweitens leisten Ausgleichszahlungen nur einen Entwicklungs- und Klimaschutzbeitrag, sofern die ausgewählten Projekte von guter Qualität sind. Im Hinblick auf die Qualität der Projekte gibt es tatsächlich Unterschiede. Ein wichtiger Aspekt ist die sogenannte Zusätzlichkeit – das heißt, dass die Klimaschutzprojekte durch die Möglichkeit des Verkaufs von Emissionszertifikaten ermöglicht und nicht ohnehin umgesetzt werden. Auch darf die Menge der berechneten Emissionsminderungen nicht überschätzt werden. Des Weiteren muss – vor allem bei Waldprojekten – sichergestellt werden, dass die erzielten Emissionsminderungen langfristig Bestand haben und die Einsparungen bereits erzielt wurden. Denn wenn ein geschützter Wald zu einem späteren Zeitpunkt gerodet wird, könnten die vorher bilanzierten Emissionen doch noch freigesetzt werden.
Projekte unterscheiden sich auch darin, ob und ggfs. welchen Beitrag sie zur nachhaltigen Entwicklung nach den „Sustainable Development Goals“ (SDGs) der Vereinten Nationen leisten. Auch hier gibt es spezielle Siegel, die Projekte mit besonders hohem Entwicklungsbeitrag herausstellen. So fordert der „Gold Standard for the Global Goals“ beispielsweise den Nachweis von Beiträgen zu zwei weiteren SDGs neben dem SDG 13 (Maßnahmen zum Klimaschutz). Darüber hinaus haben sich eigene Zusatzstandards entwickelt, die die Entwicklungswirkungen von Klimaschutzprojekten zertifizieren (u.a. CCBS, SD VISta, SOCIALCARBON). Käufer:innen von Emissionszertifikaten sollten sich daher ein gutes Bild von den Anbietenden und den genutzten Qualitätsstandards machen. Zur Hilfestellung gibt es verschiedene Leitfäden, u.a. vom Umweltbundesamt und der Web-Seite www.offsetguide.org. Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima hat sich entschieden, in ihrem Wording den Begriff der „Kompensation“ mit dem neutraleren „Ausgleich“ zu ersetzen und informiert über relevante Leitfäden und andere Hilfestellungen bei der Auswahl von Projekten.
Durch die Unterzeichnung der „Mitmacherklärung“ werden Unternehmen, Vereine, Verbände, Nichtregierungsorganisationen, Hochschulen, Institutionen, Städte, Kommunen, Behörden oder Privatpersonen Unterstützer:innen der Allianz für Entwicklung und Klima, deren Trägerin die gleichnamige Stiftung ist. Die Stiftung informiert die Unterstützer:innen über aktuelle Themen in den Bereichen nachhaltige Entwicklung, Klima und freiwilliger Ausgleich und fördert in Workshops und fachlichen Veranstaltungen, wie den regelmäßig stattfindenden Jahreskonferenzen, den Austausch untereinander und mit erfahrenen Partner:innen für Entwicklung und Klima (PEK). Interessierte Unterstützer:innen können selbst an der weiteren Ausgestaltung der Multi-Akteurs-Partnerschaft mitwirken.
Unterstützer:innen verpflichten sich, über die im Rahmen der von ihnen finanzierten Projekte erzielten Entwicklungswirkungen und Ausgleichsleistungen zu berichten. Dafür werden sie einmal jährlich von der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima kontaktiert und bei Bedarf bei der Erfassung unterstützt. Die Kommunikation über erreichte Entwicklungswirkungen und erfolgten Ausgleich von Emissionen seitens der Unterstützer:innen fördert die Sichtbarkeit der im Rahmen der Allianz von nichtstaatlichen Akteuren zusätzlich erzielten Beiträge zu Klimaschutz und nachhaltiger Entwicklung. Für ihre eigene Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit wird den Unterstützer:innen das Logo „Unterstützer:in der Allianz“ zur Verfügung gestellt.
Die Unterstützer:innen der Allianz sind hier gelistet.
Die Allianz für Entwicklung und Klima ist eine Austauschplattform/Multi-Akteurs-Partnerschaft. Die Stiftung bietet daher keine eigenen Projekte an. Sie listet Partner:innen für Entwicklung und Klima (PEK), die qualitativ hochwertige Standards für die Emissionszertifikate nutzen.
Die PEK beraten die Unterstützer:innen bei der Auswahl konkreter Projekte oder bei der Entwicklung eigener, individueller Entwicklungs- und Klimaschutzprojekte. Falls Sie Interesse an der Projektentwicklung haben sollten, können Sie sich direkt an unsere PEK wenden.
Die Teilnahme an der Allianz ist für alle Akteur:innen kostenfrei und damit nicht mit finanziellen Kosten verbunden. Unterstützer:innen verpflichten sich jedoch mit der Mitmacherklärung dazu, den zuletzt noch nicht vermeidbaren Treibhausgas-Emissionen entsprechend Investitionen in qualitativ hochwertige Klimaschutzprojekte im globalen Süden (Offsetting, Insetting, Contributions inkl. Adaption) zu tätigen, um Entwicklungswirkungen und internationalen Klimaschutz wirksam zu befördern. Sie sind dazu angehalten, hochwertigen CO2 -Ausgleich in signifikantem Umfang zu nutzen und bereits erfolgte Ausgleichsmaßnahmen zu erfassen und zu kommunizieren. Der Erwerb von Zertifikaten zum Ausgleich ist kostenpflichtig und variiert, je nach Auswahl der Anbietenden (vgl. auch 1.5).
Zur Darstellung der erfolgten Ausgleichsmaßnahmen führt die Allianz jährlich eine Abfrage durch. Hierbei werden alle Unterstützer:innen nach Details ihres Ausgleichs gefragt, z.B. in welchem Umfang und nach welchen Standards sie im vergangenen Jahr ihre Emissionen ausgeglichen haben. Durch diese Abfrage wird sichtbar, welche Wirkung die Allianz hat, aber auch welche Hürden aufgetreten sind und wo noch Unterstützungsbedarf besteht.
Die Stiftung hat ein eigenes Siegel entwickelt. Mit SDGold werden Organisationen ausgezeichnet, die sich in fünf Schritten für nachhaltige Entwicklung stark machen. Und sich damit für Entwicklung und Klima im Sinne der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen einsetzen. Mit dem verliehenen Siegel können Organisationen ihren Einsatz glaubhaft und transparent kommunizieren. Weitere Informationen zum Siegel gibt es hier.
Die Stiftung unterstützt die fachliche und logistische Umsetzung der Allianz und ist Ansprechpartnerin für Unterstützer:innen. Sie organisiert die Jahreskonferenz sowie den fachlichen Austausch unter den Unterstützer:innen, ist auf Veranstaltungen präsent und in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv. Die Stiftung begleitet die Unterstützer:innen der Allianz inhaltlich und sorgt für fachliche Informationen und Austausch. Sie setzt sich für Transparenz und Qualität im CO2 -Ausgleich ein und motiviert weitere Akteur:innen, aktiv zu werden. Auch die Bildung gehört zu den Stiftungszwecken, entsprechend vermittelt die Stiftung komplexes Wissen im Feld des globalen Klimaschutzes durch verschiedene Formate.
Die Geschäftsstelle der Stiftung befindet sich in Berlin.
Die Stiftung ist eine öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts.
Ins Leben gerufen wurde die Allianz für Entwicklung und Klima im Jahr 2018 durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Um das langfristige Wirken der Allianz für Entwicklung und Klima zu sichern, wurde sie 2020 in eine gemeinnützige Stiftung überführt. Gründerin der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).
Die Initiative Climate Neutral Now des UN Klimasekretariats (UNFCCC) und die Allianz für Entwicklung und Klima verfolgen beide das Ziel, verschiedene nichtstaatliche Akteure für nachhaltige Entwicklung und den Klimaschutz zu gewinnen, indem sie den Zugang zu Klimazertifikaten herstellen und eine Austauschplattform für diese Akteure darstellen. Climate Neutral Now ist bei der Allianz als Partner:innen für Entwicklung und Klima gelistet, daher stehen beide im Austausch miteinander, sind aber unabhängig voneinander.
Ein Unternehmen kann die Berechnung der Treibhausgasmissionen seiner Aktivitäten – Treibhausgas-Bilanzierung oder CO2-Bilanzierung – extern in Auftrag geben. Hierfür existieren verschiedene Anbieter:innen, die sich nach etablierten Standards richten (wie z.B. einschlägige ISO-Normen, Greenhouse Gas Protocol) und diese auch offenlegen. Dabei ist auf die transparente Darlegung der Berechnungsgrundlagen durch den Anbietenden zu achten. Je detaillierter und differenzierter die Berechnung erfolgt, desto genauer werden die tatsächlich verursachten Treibhausgasemissionen erfasst. Unternehmen sollten die Emissionen einbeziehen, die unmittelbar der Kontrolle des Unternehmens unterliegen (Scope 1), die auch indirekt durch Tätigkeiten des Unternehmens entstehen (Scope 2) sowie die entlang der Wertschöpfungskette verursacht werden (Scope 3).
Grundsätzlich bedeutet „Klimaneutralität“, keine negativen Auswirkungen auf das Klima zu verursachen. Das kann dadurch erreicht werden, dass möglichst wenige Treibhausgase ausgestoßen und die verbleibenden Emissionen durch Emissionszertifikate vollständig ausgeglichen werden. „Klimaneutralität“ ohne Ausgleichsaktivitäten ist in nur wenigen Fällen möglich. Es geht also um bilanzielle „Klimaneutralität“. Jedoch sollte stets im Vordergrund stehen, die Potenziale der Verringerung und Vermeidung der Emissionen maximal zu nutzen. Das Verständnis von „Klimaneutralität“ variiert unter den Unternehmen, insbesondere weil neben unterschiedlichen Jahren als Zielmarken (z.B. 2020, 2030, 2040, 2050) unterschiedliche Ambitionsniveaus zugrunde liegen: So kann man die Emissionen einbeziehen, die unmittelbar der Kontrolle des Unternehmens unterliegen, z.B. durch die Herstellung eines konkreten Produkts (Scope 1), aber auch die Emissionen, die indirekt durch Tätigkeiten des Unternehmen entstehen, wie z.B. der Energieverbrauch im Bürogebäude (Scope 2), sowie die Emissionen, die entlang der Lieferkette entstehen (Scope 3). Für unterschiedliche Branchen bedeutet „Klimaneutralität“ unterschiedliche Anstrengungen: So dürfte für ein Dienstleistungsunternehmen „Klimaneutralität“ einfacher (oder kostengünstiger) zu erreichen sein als für einen Stahlproduzenten.
Die Allianz bietet eine Austauschplattform zu nachhaltiger Entwicklung und freiwilligem CO2 -Ausgleich und vermittelt Informationen, z.B. über Anbieter:innen von Ausgleichszertifikaten, Projekttypen und Qualitätsstandards für die teilnehmenden Akteur:innen. Sie bringt Studien und Infosheets auf den Markt und steuert wissenschaftliche Vorhaben rund um den Voluntary Carbon Market (VCM).
Unterstützer:innen der Allianz wird eine einzigartige Plattform geboten, um sich mit anderen Unterstützer:innen auszutauschen. Unternehmen können von diesem großen Netzwerk der Allianz, in dem alle Branchen und Unternehmensgrößen vertreten sind, profitieren. Zudem organisiert die Stiftung regelmäßig eine Jahreskonferenz, bei der Fachliches in Vorträgen und Arbeitsgruppen diskutiert wird.
Außerdem bietet die Allianz ihren Unterstützer:innen Zugang zu ihren Partner:innen für Entwicklung und Klima (PEK), die gewisse Standards bezüglich der finanzierten Projekte in Ländern des Globalen Südens erfüllen müssen, um Irreführungen und Reputationsschäden der Unternehmen auszuschließen.
Außerdem stellt die Stiftung auf ihrer Webseite den Navigator als Tool für die Themen nachhaltige Entwicklung und CO2 -Ausgleich bereit.
Mit der Teilnahme der Allianz können sie sich als Vorreiter:in positionieren, denn der Klimawandel ist eine der wichtigsten Fragen der Menschheit. Als Unterstützer:in der Allianz agieren Sie zukunftsorientiert, schaffen nachhaltige Perspektiven für Länder des Globalen Südens und schützen das Weltklima mithilfe eines wirkungsvollen CO2 -Ausgleichs.
Der Beitritt zur Allianz ist kostenfrei. Reisekosten für die Teilnahme an Veranstaltungen der Allianz müssen von den Unterstützer:innen selbst getragen werden. Unterstützer:innen entscheiden selbst, wie aktiv sie sich in die Arbeit der Allianz einbringen möchten. Aktives Engagement in der Jahreskonferenz ist ausdrücklich erwünscht. Ebenso die Werbung für Entwicklungsförderung und Klimaschutz in den eigenen Netzwerken und Gewinnung weiterer Unterstützer:innen für die Allianz. Verbindlich ist die Beteiligung an der jährlichen Abfrage bezüglich erfolgter Kompensation.
Das Unternehmen muss in nennenswertem Umfang Projekte mit positiver Entwicklungs- und Klimaschutzwirkung in Ländern des Globalen Südens fördern und bereit sein, darüber jährlich an die Stiftung zu berichten. Sind diese Punkte erfüllt, genügt es, die „Mitmacherklärung“ auszufüllen.
Die Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima bietet ihren Unterstützer:innen ein von unabhängiger Instanz geprüftes Siegel an. Mit dem Siegel SDGold werden Organisationen ausgezeichnet, die sich für nachhaltige Entwicklung stark machen. Und sich damit für Entwicklung und Klima im Sinne der Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen einsetzen. Mit dem verliehenen Siegel, das dies in fünf Schritten bemisst, können Organisationen ihren Einsatz glaubhaft nachweisen und transparent kommunizieren. Weitere Informationen dazu gibt es hier.
Die Allianz ersetzt keine nationalen Emissionsminderungsverpflichtungen, weder staatliche im Rahmen des Pariser Abkommens (und der nationalen Klimabeiträge oder Nationally Determined Contributions, NDCs) noch die von Unternehmen innerhalb des Europäischen Emissionshandelssystems (EU-ETS).
Der verpflichtende Markt bspw. über das Europäische Emissionshandelssystems (EHS) betrifft nur eine Auswahl von Anlagen – überwiegend in der Energiewirtschaft und in bestimmten energieintensiven Sektoren – in der Europäischen Union. Die freiwillige Kompensation geht über die verpflichtenden Ziele des EHS hinaus, indem sie die verbleibenden Emissionen aus EHS-Anlagen kompensiert oder Emissionen adressiert, die nicht vom EHS erfasst sind.
Die CO2 -Steuer ist ein effektiver Anreiz, mit dem Menschen zu mehr klimafreundlichen Handeln bewegt werden. Dabei wird die Nutzung von treibhausgasintensiven Produkten, wie z.B. fossiler Brennstoffe, sukzessive verteuert, woraufhin sich aktuell rentable, aber auf CO2 basierende Aktivitäten und Investitionen nicht mehr lohnen. Dadurch rücken Investitionen in alternative und treibhausgasarme Innovationen in den Fokus. Das übergeordnete Ziel der CO2 -Steuer ist somit die Reduktion von Kohlendioxidemissionen. Jeder nichtstaatliche Akteur hat aber auch schwer vermeidbare Emissionen vorzuweisen. Hier kommt der Ausgleich ins Spiel. Um „Klimaneutralität“ zu erreichen, muss ein Akteur oft zugleich Emissionen vermeiden, reduzieren und ausgleichen. CO2 -Steuer und Ausgleich sind also zwei unterschiedliche Möglichkeiten, um das Klima zu schützen, die sich komplementieren und die beide wichtig zur Erreichung der „Klimaneutralität“ sind. Es ist im Vorfeld allerdings immer wichtig, bestimmte Emissionen so weit wie möglich zu vermeiden und zu reduzieren, bevor der Ausgleich umgesetzt wird.
Im Kontext des Pariser Klimaabkommens haben sich die Umstände für den freiwilligen Kohlenstoffmarkt ebenfalls geändert, nachdem die Verhandlungen zu den internationalen Kooperationsmechanismen zwischen Staaten unter Artikel 6 abgeschlossen wurden und letzte technische Ausgestaltungen der neu geschaffenen Bedingungen noch ausstehen. Mit den Nationally Determined Contributions (NDCs) haben nun alle Staaten Klimaschutzverpflichtungen, die alle fünf Jahre ambitionierter werden sollen. Damit durch diese neuen Rahmenbedingungen keine Doppelzählung von Emissionsminderungen stattfindet und die Umweltintegrität gewahrt wird, ist ein sog. Corresponding Adjustment (CA) vorgeschrieben. Dies kann Auswirkungen auf die Menge verfügbarer Zertifikate und ein Risiko der Doppelzählung von Emissionsminderungen haben.
Über neue Ergebnisse informiert die Stiftung alle Unterstützer:innen der Allianz für Entwicklung und Klima durch entsprechende Informationsmaterialien und Veranstaltungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserem Infosheet.
Durch das Modell der sog. „Contribution Claims“ entsteht derzeit eine Alternative zum klassischen Modell der „Kompensation“. Durch sie können ebenso finanzielle Investitionen in Klimaschutz- bzw. Nachhaltigkeitsprojekte im Globalen Süden getätigt werden. Die Investitionen können z.B. dazu beitragen, dass die Gaststaaten der Projekte ihre Klimaschutzpläne (Nationally Determined Contributions, NDCs) umsetzen und einhalten sowie weitere Aspekte der nachhaltigen Entwicklung stärken können. Ein Contribution Claim sollte sich insbesondere am bestmöglichen Beitrag zur Erreichung der globalen Klimaschutzziele in Sinne der Klimaverantwortung orientieren.
Ein „Contribution Claim“ lässt sich nicht mit der Treibhausgasbilanz eines Unternehmens verrechnen, um so z. B. „Klimaneutralität“ zu erreichen. Es entfällt jedoch auch das Risiko der Doppelzählung von Emissionsminderungen (siehe 5.4 Pariser Klimaabkommen).
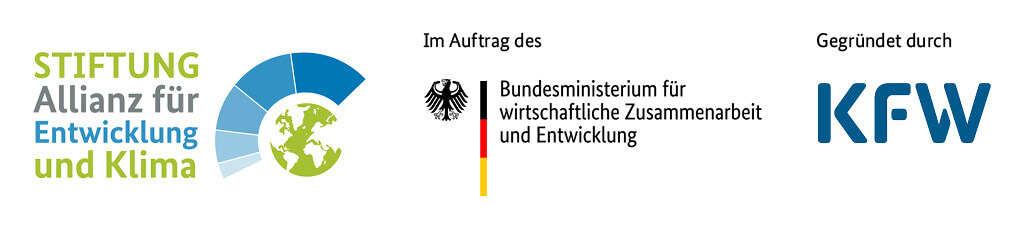
Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima
Chausseestraße 22
10115 Berlin
Telefon: +49 30 3465573-00
E-Mail: info@allianz-entwicklung-klima.de
Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima
Chausseestraße 22
10115 Berlin
Telefon: +49 30 3465573-00
E-Mail: info@allianz-entwicklung-klima.de