
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Bildung für nachhaltige Entwicklung – was ist das?
Ziel ist es, Wissen zu vermitteln, das Menschen befähigt, die Welt und ihre Zukunft nachhaltig zu gestalten. So, dass alle Menschen weltweit ihre Bedürfnisse und Talente entfalten können, ohne die Stabilität globaler Ökosysteme zu gefährden. Herausforderungen gibt es dabei mehr als genug: Die Eindämmung des Klimawandels, Sicherstellung der Welternährung und eine faire Globalisierung. Bei all dem tickt die Uhr – viel Zeit haben wir nicht. Um diese Mammutaufgabe anzugehen, brauchen Menschen Wissen. Wissen, das sie befähigt, die Welt nachhaltig und gerecht zu gestalten.
Deshalb wurde durch die Vereinten Nationen die Dekade der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen. Sie ist ein wichtiger Treiber der Agenda 2030 und trägt zur Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele, der SDGs, bei. Von Kindergärten über Schulen bis Hochschulen; in der beruflichen Bildung, in Kommunen, Vereinen, Kultureinrichtungen oder Unternehmen sollen Handlungskompetenzen, kritisches Denken und neue Perspektiven vermittelt werden. Damit Menschen verstehen, welche globalen Auswirkungen unser Handeln hier vor Ort hat und verantwortungsvolle, nachhaltige Entscheidungen treffen können. Für heute und morgen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Was bedeutet der Contribution Claim Ansatz für Unternehmen und andere Organisationen? Im Kampf gegen die Erderwärmung haben sich viele Unternehmen und Organisationen Klimaschutzziele gesetzt. Diese rücken oft die bilanzielle Neutralität des Unternehmens in den Fokus. Das heißt, Emissionen werden entlang der eigenen Wertschöpfungskette vermieden und reduziert. Restliche, nicht weiter zu reduzierende Emissionen werden dann durch externe Zertifikate ausgeglichen, um die eigenen Emissionen auf Null zu setzen.
Der Contribution Claim Ansatz ist eine Alternative zum Klimaneutralitätsziel und der damit in der Regel verbundenen CO2-Kompensation. Unternehmen und Organisationen können so ambitionierte Klimaschutzprojekte unterstützen, die erzielten Emissionsminderungen aber nicht für ihre eigene Klimaschutz-Bilanz beanspruchen. Es handelt sich also um ein freiwilliges, zusätzliches Engagement, das in der Emissionsbilanz nicht sichtbar ist. Warum sollten Unternehmen und Organisationen das tun?
Dieses Vorgehen ermöglicht die Unterstützung von Projekten, die z.B. in den jeweiligen Ländern zu Klimaengagement beitragen oder über eine Klimawirkung hinaus nachhaltige Entwicklung wirksam voranbringen.
Mindestens genauso wichtig ist aber dies: Wenn die Welt bis 2050 keine Netto-Treibhausgasemissionen mehr ausstoßen will, muss eine Finanzierungslücke von mehreren hundert Billionen US-Dollar überwunden werden. Zusätzliche Klimafinanzierung nach dem Contribution Claim Ansatz zu leisten, ist ein wichtiger Weg für Unternehmen und Organisationen, ihrer Klimaverantwortung im Einklang mit dem Abkommen von Paris gerecht zu werden. Und so als Vorreiter in Sachen Klimaschutz aktiv zu werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Was ist Insetting? Und wie unterscheidet es sich vom Offsetting?
Offsetting ist die Förderung von Klimaschutzprojekten. Dazu messen Unternehmen zunächst ihre Emissionen, vermeiden und reduzieren sie und gleichen die restlichen, nicht weiter zu senkenden Treibhausgas-Emissionen aus. Dieser Ausgleich steht jedoch nicht zwingend in Verbindung zur eigenen Wertschöpfungskette.
Beim Insetting ist das anders. Hier wird Klimaschutz entlang der eigenen, direkten und indirekten Wertschöpfung angesetzt und erzielt damit einen ganzheitlichen Wandel etablierter Prozesse und Handlungen. Konkret können durch Insetting lokale Biodiversität, Wassereinsparung oder Recyclingfähigkeit von Produkten der Lieferkette gesteigert werden. Aber auch Kriterien zu Corporate Social Responsibility werden als Messfaktoren herangezogen. Damit stellt Insetting einen ganzheitlichen Ansatz dar – mit Wirkung auf lokale Ökosysteme, Gesellschaften und Wirtschaftsstrukturen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass Offsetting als freiwillige Klimaschutzmaßnahme Emissionen ausgleicht, während Insetting einen tiefgreifenden Wandel des Unternehmens anstrebt und Stakeholder-Beziehungen stärkt. Dabei müssen beide Ansätze nicht als Alternativen zueinander betrachtet werden: Aus der übergeordneten Zielsetzung der CO2- Reduktion lassen sich sowohl Maßnahmen zum Offsetting als auch zum Insetting ableiten – die einen positiven Einfluss auf umfangreiche Nachhaltigkeitsziele ausüben können.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Welche Co-Benefits können Klimaschutzmaßnahmen haben?
Co-Benefits sind die Zusatznutzen, die Klimaschutzprojekte neben der Emissionsminderung im Projektgebiet haben können. Das können zum Beispiel der Erhalt von Artenvielfalt, eine verbesserte Luftqualität oder der Aufschwung nachhaltiger Technologien sein. Besondere Bedeutung kommen solchen Zusatznutzen zu, die Entwicklungswirkungen im globalen Süden aufweisen. Und damit den Menschen vor Ort zugutekommen. Diese Entwicklungswirkungen zahlen auf die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN ein – den Sustainable Development Goals, kurz SDGs.
Ein Beispiel macht das deutlich: In einem Projekt werden kleine Biogasanlagen gebaut. Die Maßnahme trägt zu einer positiven Klimawirkung und dem Ausbau bezahlbarer und sauberer Energie bei. Als Co-Benefit werden auch die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort verbessert. Frauen und Mädchen müssen sich beispielsweise nicht mehr auf Holzsuche zur Energiegewinnung begeben. Zeit und finanzielle Ressourcen werden gespart, die in die Bildung von Mädchen und jungen Frauen reinvestiert werden. Dies leistet einen Beitrag zum SDG 4 „Chancengerechte und hochwertige Bildung“. Außerdem wird durch die Vermeidung von Abholzung der Wälder die Biodiversität an Land geschützt. Dieses beispielhafte Projekt macht deutlich, dass nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz über Co-Benefits eng miteinander verknüpft sind und sinnvollerweise immer zusammengedacht werden müssen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Welche Qualitätskriterien gilt es beim Treibhausgas-Ausgleich zu beachten? Und was bedeutet Zusätzlichkeit in diesem Zusammenhang? Um eine positive Wirkung von Klimaschutzprojekten zu gewährleisten, gilt es einige Kriterien zu beachten. Eines der wichtigsten ist die Zusätzlichkeit. Es muss also gewährleistet sein, dass das Projekt nicht ohnehin durchgeführt worden wäre. Bei der Prüfung der Kriterien kann man zwischen zwei Formen unterscheiden.
a) Die finanzielle Zusätzlichkeit Hier wird sichergestellt, dass die Klimaschutzmaßnahme des Projekts ohne die Erlöse aus dem Verkauf der Zertifikate nicht hätte umgesetzt werden können. Maßnahmen, die bereits wirtschaftlich sind, kommen somit als zertifizierte Klimaschutzprojekte nicht in Betracht. Unter
b) der regulatorischen Zusätzlichkeit wird geprüft, dass die Minderung aus dem Projekt nicht gesetzlich vorgeschrieben ist oder der gängigen Praxis der Region entspricht.
Um beide Formen prüfen zu können, wird zunächst ein Referenzszenario entwickelt. Dieses sagt aus, wie sich die Treibhausgasemissionen ohne die Klimaschutzmaßnahme entwickelt hätten. Durch einen Vergleich des Referenzszenarios mit den zu erwartenden Projektemissionen der Klimaschutzmaßnahme kann die Emissionsminderung berechnet werden. Die Zusätzlichkeit stellt also sicher, dass durch den Verkauf von Zertifikaten eine zusätzliche CO2-Minderung erzielt wird.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Permanenz als Qualitätskriterium – was bedeutet das für Klimaschutzprojekte? Um sicherzustellen, dass Projekte zum Treibhausgasausgleich eine positive Wirkung auf das Klima haben, gilt es verschiedene Kriterien zu berücksichtigen. Permanenz ist dabei von zentraler Bedeutung. Es muss sichergestellt werden, dass die Emissionsminderungen des Klimaschutzprojektes von Dauer sind. Bei Waldprojekten könnten z.B. Brände, Schädlingsbefall oder illegale Abholzung die Emissionsminderung und -speicherung gefährden. Denn dann wird die gespeicherte Menge CO2 wieder freigesetzt. CO2 bleibt nämlich nur so lange gebunden, bis die Biomasse zersetzt wird.
Um Permanenz zu gewährleisten, fordern Qualitätsstandards Risikoanalysen ein oder schließen bestimmte, gefährdete Projekttypen aus. Puffer mindern das Risiko weiter ab. Bei einem Waldprojekt werden als Puffer z.B. 20 – 30% der gesamten CO2-Minderungen nicht in Form von Zertifikaten ausgegeben. Diese fließen in eine gemeinschaftliche Reserve, auf die im Unglücksfall zurückgegriffen werden kann.
Zusammenfassend kann man also sagen, dass Permanenz von Klimaschutzprojekten sicherstellt, dass die Emissionsminderung dauerhaft angelegt ist.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Was sind Corresponding Adjustments?
Um eine Antwort zu finden, blicken wir zunächst in das Jahr 2015 – auf das Übereinkommen von Paris. Hier haben sich die inzwischen 195 Vertragsstaaten dazu verpflichtet, eigene Emissionsreduktionsziele zu setzen und zu verfolgen. Und daraus ergibt sich eine mögliche Doppelzählung. Ein Beispiel: Ein deutsches Unternehmen kauft Zertifikate für ein Kochherd-Projekt in Äthiopien, mit dem 1.000 Tonnen CO2 kompensiert werden können. Im Falle einer Doppelzählung würden die 1.000 Tonnen CO2 sowohl in Äthiopien für die nationale Emissionsreduktion angerechnet als auch beim deutschen Unternehmen. Auf globaler Ebene käme es so zu einer Verfälschung der Emissionsbilanzen. Um diese Doppelzählung zu verhindern, sind Corresponding Adjustments notwendig. Auf unser Beispiel angewendet würde das bedeuten, dass Äthiopien Deutschland die Übertragung der Minderung genehmigen muss und damit die 1.000 Tonnen CO2 nicht auf die eigenen Emissionsreduktionsziele verbuchen darf. Deutschland dürfte die 1.000 Tonnen CO2 mit der Genehmigung von Äthiopien auf die eigene Bilanz anrechnen. Corresponding Adjustments sind also eine Maßnahme zur Anpassung der Emissions-Bilanzen. Sie führt auch dazu, die Beiträge aller Länder zum globalen Klimaschutz zu erhöhen und im Sinne der Weltgemeinschaft zu handeln.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Wie bekommen wir Menschen die Klimafolgen zu spüren?
Der Klimawandel kommt mit unterschiedlichen Auswirkungen auf uns zu: Auf der einen Seite häufen sich tropische Hitze- und Dürreperioden und auf der anderen Seite Starkregen und Überschwemmungen.
Dass Extremwetterereignisse und Unwetterkatastrophen sich auch in Deutschland häufen, wissen wir spätestens seit der Jahrhundertflut im Ahrtal 2021. Aber wie sieht es denn dann im globalen Süden aus? Dort wo die Erderwärmungs-Folgen schon länger deutlich spürbar sind und gleichzeitig auf strukturschwache Regionen treffen?
Bangladesch gehört zum Beispiel zu den ärmsten Ländern der Welt und gleichzeitig zu den am stärksten von der Erderwärmung betroffenen Regionen. Das liegt an der geografischen Lage mit dem Himalaya im Norden und dem Golf von Bengalen im Süden. Während Regenmassen aus dem Gebirge das Land von innen überfluten können, fallen Sturmfluten vom Meer mit bis zu fünf Metern besonders hoch aus. Und ein Anstieg des Meeresspiegels um einen Meter würde 30.000 Quadratkilometer Land überfluten und in Ozean verwandeln. Diese massiven Überschwemmungen führen in der Bevölkerung schon jetzt zu Krankheiten, Hungersnöten und dazu, dass Menschen ihre Heimat verlassen.
Um diese gravierenden Folgen der Erderwärmung gerade im globalen Süden abzumildern, müssen wir Industrienationen unserer Verantwortung gerecht werden und dort handeln, wo es schon jetzt die ärmsten der Armen trifft. Die Finanzierung von Klimaschutz-Projekten, die der Entwicklung vor Ort dienen, ist eine bereits heute praktikable Unterstützung.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Wie können Unternehmen Emissionen reduzieren?
Vor der Frage, wie sich Treibhausgas-Emissionen verringern lassen, werden Möglichkeiten ergriffen, den Ausstoß von Treibhausgasen komplett zu vermeiden. Emissionen durch Reiseverkehr lassen sich zum Beispiel vermeiden, indem statt eines internationalen Meetings ein digitales Treffen angesetzt wird.
Lassen sich Emissionen aber nicht komplett vermeiden, muss man genauer schauen: Welche Emissionen lassen sich weiter senken? Und wie?
Ein wichtiger Punkt ist das Thema Energie. Die Erzeugung von Strom und Wärme macht in Deutschland insgesamt rund 80% der ausgestoßenen Treibhausgase aus. Die Umstellung auf erneuerbare Energien bietet das größte Potenzial ihrer Reduktion. Auch die Steigerung von Energieeffizienz kann in großem Maße dazu beitragen. Prozessoptimierung oder die Umstellung der Beschaffung auf Nachhaltigkeit sind wichtige Stellschrauben, Emissionen des Unternehmens zu reduzieren. Doch die Wege zur Emissionsreduktion sind so individuell wie jedes Unternehmen selbst. Deshalb steht an erster Stelle eine Emissionsbilanz, die für das Unternehmen erstellt wird. Aus ihr leiten sich Ziele, Strategien und konkrete Maßnahmen ab. Und das ist

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Science Based Targets – was genau ist das?
Science Based Targets, also wissenschaftsbasierte Ziele, sind Reduktionsziele von Treibhausgasemissionen für Unternehmen. Sie setzen die Menge an Emissionen in den Fokus, die reduziert werden muss, um das Pariser Abkommen zu erfüllen und die Erderwärmung auf unter 2 °C und im besten Fall auf 1,5 °C zu begrenzen. Im Zusammenhang mit Science Based Targets werden konkrete Methoden und Kriterien entwickelt sowie deren Validierung sichergestellt. Sie bieten für Unternehmen Werkzeuge zur Zielsetzung und auch zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Die Ziele konzentrieren sich auf Emissionsreduktionen innerhalb der unternehmenseigenen Wertschöpfungskette, sowie auf vor- und nachgelagerte Leistungen, wie z.B. in der Rohstoffproduktion und dem anschließenden Recycling. Unternehmen übernehmen so mit ihren Zielen auch Verantwortung für indirekte Emissionen, beispielsweise von Lieferant:innen, genutzter Energie oder Transportketten. Externe Klimaschutz-Zertifikate durch Treibhausgas-Ausgleich dürfen von Unternehmen demnach nicht als Mittel zur Erreichung der Ziele herangezogen werden. Als zusätzliche Maßnahme zum Klimaschutz werden Unternehmen jedoch zu diesem Schritt ermutigt.
Insgesamt gilt: Durch Science Based Targets haben Unternehmen die Chance, ihre eigenen Ziele und Maßnahmen am Pariser Abkommen auszurichten. Und damit einen wichtigen Beitrag zu globalem, wissenschaftlich validiertem Klimaschutz zu leisten.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Was sind eigentlich Kohlenstoffsenken?
Wälder, Moore und Ozeane sind natürliche Reservoirs für CO2, also Kohlenstoffdioxid. Diese Kohlenstoffsenken nehmen mehr CO2 auf, als sie abgeben und spielen damit eine wichtige Rolle für das globale Klima.
Effektive Klimaschutz-Projekte machen sich diese natürlichen Kapazitäten von Kohlenstoffsenken zu Nutze. Zum Beispiel Aufforstungsprojekte: Wälder nehmen CO2 aus der Atmosphäre auf und wandeln es mit der Hilfe von Sonnenlicht durch Photosynthese in Sauerstoff um. Zertifizierte Klimaschutzprojekte zur Aufforstung zählen damit zu den sogenannten Carbon Removal Projects – also Projekten zur Entfernung von bereits in die Atmosphäre entlassenen Kohlenstoffdioxids. Neben natürlichen Carbon Removal Projects mit der Hilfe von Kohlenstoffsenken gibt es auch technische Varianten, der Luft CO2 zu entnehmen.
Carbon Avoidance Projects hingegen verringern den Ausstoß von Emissionen, ohne dabei Treibhausgas-Emissionen aus der Atmosphäre zu binden. Dazu zählen zum Beispiel Projekte zu erneuerbaren Energien, effizienten Kochöfen und vieles mehr.
Klar ist – Kohlenstoffsenken, also Wälder, Moore und Ozeane, sind für das Klima unserer Welt von enormer Bedeutung. Dennoch ist nach wie vor am wichtigsten, so wenig CO2 wie möglich in die Atmosphäre zu entlassen. Und die Nutzung von Kohle, Gas und Öl deshalb deutlich zurückzufahren.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Was ist das eigentlich?
Als klimaverantwortlich gelten diejenigen, die ursächlich zur Erderwärmung beitragen.
Das sind vor allem Industrienationen im globalen Norden. Während sie seit Beginn der Industrialisierung am meisten Treibhausgase ausstoßen, leiden Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern schon heute unter den Folgen des Klimawandels. Obwohl sie am wenigsten dazu beigetragen haben. Und hier trifft es vor allem die Ärmsten – Überschwemmungen, Stürme und Dürren führen unter anderem zu Ernteausfällen und Gesundheitsrisiken. Und machen Millionen von Menschen zu Klimaflüchtlingen.
Doch Klimaverantwortung tragen wir nicht nur für die Menschen, mit denen wir heute diesen Planeten teilen, sondern auch für kommende Generationen. Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, sollten wir die Bedürfnisse der Gegenwart so befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden.
Nachhaltiges und klimaverantwortliches Handeln ist dabei am besten gleichzeitig:
Sozial gerecht,
ökologisch tragfähig,
wirtschaftlich effizient.
Und das gilt für Staaten und Kommunen, genauso wie für Konzerne und Start-ups, oder auch privat für Dich und mich. Denn wir alle sind verantwortlich für Klima und Zukunft auf diesem Planeten. Wir sollten uns unserer Klimaverantwortung also einerseits bewusst werden und andererseits entsprechend handeln. Warum also nicht nachhaltige Perspektiven für Menschen im globalen Süden schaffen und zugleich unsere eigene Zukunft sichern?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Was sagt das 1,5 Grad-Ziel aus?
2015 einigten sich die UN-Vertragsstaaten im Pariser Klimaabkommen darauf, die durchschnittliche Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen.
1,5-Grad oder 2-Grad wärmer – was macht das für einen Unterschied?
Angenommen, wir erreichen bis 2100 eine Erwärmung um 2-Grad anstatt 1,5-Grad, dann sterben alle der Korallenriffe weltweit anstatt „nur“ 70%. Und das Risiko für Hochwasser und Starkregen liegt dann bei 170% statt bei 100%.
Ok. Verstanden. 1,5-Grad ist also das erklärte Ziel. Was gibt es zu beachten?
Zum einen: Kipppunkte. Sie sind die Achillesfersen im Erdsystem. Das Eis an Nord- und Südpol ist einer dieser Kippelemente. Schmelzende Eisflächen reflektieren weniger Sonnenlicht, was den kühlenden Effekt verhindert. Weitere Kippelemente sind z.B. der Regenwald im Amazonas, das Entweichen von Methan in Permafrostböden oder auch die von Versauerung bedrohten Ozeane. Diese fragilen Schätze unseres Erdsystems gilt es besonders zu schützen, um Klimastabilität zu erreichen.
Ebenso wichtig: Die nachhaltige Entwicklung im globalen Süden. Diese muss durch Förderung z.B. in emissionsarmer Energiegewinnung unterstützt werden. Denn wenn bei steigendem Energiebedarf und sich ändernden Konsummustern kohlenstoffintensive Technologien nicht übersprungen werden, werden wir die globalen Klimaziele verfehlen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Die Agenda 2030 wurde 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Ziel ist es, bis 2030 nachhaltige Entwicklung von globaler Dimension zu erreichen. Dabei richtet sie sich gleichermaßen an alle Staaten, Unternehmen, zivile Organisationen, Städte, Gemeinden und Privatpersonen.
Und was genau steht drin?
Kern der Agenda 2030 sind die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die Sustainable Development Goals oder auch SDGs. Diese Ziele umfassen alle drei Dimensionen von Nachhaltigkeit: Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt. Sie sollen bis 2030 von allen Entwicklungs- und Schwellenländern sowie den Industriestaaten erreicht werden.
Gleich mehrere Ziele können durch die Förderung hochwertiger Klimaschutzprojekte umgesetzt werden. Ein Beispiel macht das deutlich.
In Raichur, Indien – wird das traditionelle Kochen auf Feuerstellen durch nachhaltige Kochherde ersetzt. Dadurch werden drei SDGs erreicht:
Ziel 15: Leben an Land
Der Herd benötigt 70% weniger Brennholz. Die Abholzung der Wälder wird vermindert. Das ist in Raichur wichtig, denn die Region ist sehr trocken.
Ziel 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
Durch Verringerung des Brennholzes reduzieren sich auch die Treibhausgasemissionen.
Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen
Weniger gesundheitsschädlicher Rauch trägt zu besserer Gesundheit bei. Gut. Wir sehen also, wie internationale Zusammenarbeit die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 praktisch umsetzt. Durch Förderung von Klimaschutzprojekten kannst auch Du zur Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele beitragen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Kohlenstoffmärkte – gibt es mehrere?
Ja. Zunächst unterscheidet man zwischen verpflichtenden und freiwilligen Kohlenstoffmärkten.
Über verpflichtende Kohlenstoffmärkte können Staaten mit Emissionsrechten handeln. Hintergrund ist die Klimakonferenz in Kyoto 1997: Hier verpflichteten sich Industrienationen erstmals, verbindlich ihren Treibhausgasausstoß zu mindern.
Wenn also heute ein Land weniger emittiert als ihm zugestanden wurde, darf es mit den verbleibenden Emissionsrechten handeln. Mit dem Klimaschutzabkommen von Paris wurde das System weiterentwickelt. Nun sollen alle Länder der Welt alle fünf Jahre eigene, ehrgeizige Klimaschutzbeiträge vorlegen. Zudem verpflichten sich die Industrieländer, die Staaten des globalen Südens beim Klimaschutz und der Anpassung an den Klimawandel zu unterstützen. Die Erfolge bleiben aber hinter den Zielen des Pariser Abkommens zurück.
Darum ist der freiwillige Markt so wichtig: Hier geht es um den Ausgleich unvermeidbarer Emissionen von Privaten in konkreten Projekten, die zusätzlichen Klimaschutz ermöglichen. Wichtig ist, daneben auch nachhaltige Entwicklung zu fördern. Diese Projekte werden von nicht-staatlichen Zertifizierern geprüft. In Deutschland werden die Standards der Organisationen Gold Standard und Verra am häufigsten genutzt. Sie prüfen die Gestaltung und Durchführung der Projekte und ihre wirtschaftliche, soziale und ökologische Wirkung. Außerdem darf es bei Klimaschutzprojekten nicht zur Doppelzählung kommen: Staatliche und freiwillige Minderungsleistung mit demselben Projekt darf nur einmal angerechnet und zertifiziert werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Was ist eigentlich Klimaneutralität?
Im Rahmen des Pariser Klimaabkommens beschloss die internationale Staatengemeinschaft, bis 2050 klimaneutral zu werden. Aber was ist Klimaneutralität genau?
Meist wird es definiert als ein Gleichgewicht, das erreicht werden muss, zwischen den global ausgestoßenen und aufgenommenen Treibhausgasen. Es dürfen also nur so viele Emissionen ausgestoßen werden, wie durch Kohlenstoffsenken wieder aufgenommen werden können. Diese Senken können beispielsweise Wälder oder Moore sein.
Häufig wird auch der Begriff „Netto-Null“ verwendet.
Bei einer Netto-Null-Klimaschutzstrategie setzen sich Unternehmen Ziele zur Vermeidung und Reduktion von Treibhausgas-Emissionen, die dem weltweiten 1,5-Grad Ziel entsprechen. Nur die danach nicht mehr vermeidbaren Emissionen, werden durch Investitionen in hochwertige Klimasenken ausgeglichen.
Zusätzlich sollen Finanzierungsbeiträge für globale Klimaschutzmaßnahmen getätigt werden, die außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette liegen und zum Beispiel Projekte im Globalen Süden fördern.
Durch Netto-Null und globale Klimaschutzbemühungen können also auch finanziell schwächere Länder bei nachhaltigen Investitionen unterstützt werden. Was Klimaneutralität und Netto-Null gemeinsam haben? Zunächst muss mit der Emissionsbilanz errechnet werden, wieviel wir überhaupt ausstoßen. Dann müssen Treibhausgase vermieden, verringert und ausgeglichen werden. Und das am besten so schnell und so umfassend wie möglich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Ganzheitliche Klimaschutzstrategien für Unternehmen – wie geht das?
Klimaschutz betrifft uns alle. Eine besondere Verantwortung tragen aber Unternehmen. Klimafreundlich zu handeln zeigt unternehmerische Verantwortung und hilft dabei, zukunftsfähig zu bleiben. Startpunkt ist die Emissionsbilanz. Mit ihr misst das Unternehmen, wie viele Treibhausgase es ausstößt. Daraus werden Ziele zur Minderung von Emissionen abgeleitet. Glaubwürdige Klimaschutzstrategien basieren auf wissenschaftlich fundierten Zielen. Sie orientieren sich daran, wie viel überhaupt noch ausgestoßen werden darf, wenn die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden soll.
Es müssen zudem ambitionierte Zwischenziele festgelegt werden. Die so gesetzten Ziele werden nun auf Unternehmensebene entlang der gesamten Wertschöpfungskette umgesetzt.
ABER: Eine ganzheitliche Klimaschutzstrategie fußt auf dem Prinzip umfassend und schnell zu vermeiden, zu reduzieren sowie zusätzlich zu kompensieren. Emissionen, die nicht vermieden oder weiter reduziert werden können, können über hochwertige Klimaschutzzertifikate ausgeglichen werden. Wichtig ist, dass der Ausgleich ergänzend zur Vermeidung und Reduktion der Emissionen geschieht.
Dabei werden Emissionen durch hochwertige Klimaschutzprojekte an anderer Stelle in mindestens gleicher Höhe vermieden oder entfernt. Ein anderer Weg sind Finanzierungsbeiträge zum Klimaschutz ohne Anrechnung auf die eigene Klimabilanz. Beide Wege fördern nachhaltige Entwicklung und emissionsarme Technologien dort, wo sie noch nicht im Einsatz sind. Das schützt die Umwelt und kann gleichzeitig Armut mindern. Unternehmen können so durch ganzheitlichen Klimaschutz ihrer gesellschaftlichen und globalen Verantwortung auf mehreren Ebenen gerecht werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Welche unterschiedlichen Klimaschutzprojekte gibt es?
Projekte für den zusätzlichen Klimaschutz unterscheiden sich in ihrer Art, im Umfang, ihrer geographischen Lage und in Bezug auf ihre Zielgruppe. Sie sparen nicht nur unterschiedlich viele Emissionen ein, sondern haben verschiedene Wirkungen auf das Umfeld, in dem sie durchgeführt werden.
Und welche unterschiedlichen Klimaschutzprojekte gibt es?
Als Beispiele für die Vermeidung von THG-Emissionen gibt es z.B.:
a) Energie-Projekte, die z.B. mit erneuerbaren Energien, Gewinnung von Biogas oder effizienten Kochherden Emissionen reduzieren.
Oder zur Bindung und dauerhaften Speicherung von THG-Emissionen z.B.:
b) sog. Naturbasierten Lösungen oder Nature-based Solutions:
Hier wird Kohlendioxid durch natürliche Senken gespeichert. Dazu zählen Waldschutz, der Schutz von Mangroven oder die Wiedervernässung von Mooren.
Bei Forstprojekten muss darauf geachtet werden, dass sie über Jahrzehnte bestehen bleiben, bis sie ihre vollständige Kapazität an CO2-Speicherung erreichen. Außerdem müssen bei Waldprojekten Konflikte bei der Landnutzung – zum Beispiel mit der indigenen Bevölkerung – vermieden werden.
Dann können die Projekte nach entsprechenden Qualitätskriterien nachhaltige Entwicklung und Klimaschutz sinnvoll miteinander verknüpfen – und auch die sozialen und ökonomischen Bedingungen der Bevölkerung verbessern.
So bringt jede zusätzlich eingesparte Tonne CO2 nicht nur mehr Klimaschutz, sondern trägt auch zu mehr Bildung, Arbeitsplätzen und besserem Schutz der Gesundheit bei.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Trägt Treibhausgasausgleich wirklich zur Klimaneutralität bei?
Angenommen, ein Unternehmen stößt nach wie vor Treibhausgase aus, als würde es den Klimawandel nicht geben. Es gleicht Emissionen nur aus, indem es Kompensationszahlungen leistet und bemüht sich nicht um deren Vermeidung und Reduktion.
Klingt nach Greenwashing? Ist es auch, wenn es so abläuft wie geschildert.
Treibhausgasausgleich oder CO2-Kompensation kann jedoch einen richtigen und wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, wenn man Folgendes beachtet.
Ganzheitlicher Klimaschutz besteht aus drei Säulen: Vermeiden, verringern und die unvermeidbaren Restemissionen kompensieren.
Konkret sieht das so aus: Ein Unternehmen misst seine Emissionen, stellt Ziele zur Vermeidung und Reduktion auf und setzt diese Ziele um. Dadurch werden Innovationen angestoßen, neue Technologien und Verhaltensweisen etabliert. Nur Emissionen, die nach aktuellem Stand unvermeidbar sind, werden anschließend kompensiert. Damit stellt Kompensation eine Möglichkeit dar, direkt aktiv zu werden und schnell im Sinne des Klimas zu handeln. Und auch einen Beitrag im Sinne der Klimagerechtigkeit zu leisten: Denn die privaten Mittel aus dem globalen Norden schieben durch Klimaschutzprojekte im globalen Süden auch dort grüne Innovationen an.
Zurück zu unserer Frage: Trägt Treibhausgasausgleich wirklich zur Klimaneutralität bei? Die Antwort lautet ja. Wenn Emissionen gleichzeitig verringert und vermieden werden. Dann ist Treibhausgasausgleich ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, der ganz konkret und weltweit wirkt.

Die Moderatorin, Speakerin und Autorin setzt das Thema Nachhaltigkeit seit rund 10 Jahren in den Fokus. Durch ihre Moderationserfahrung bei „grünen“ Events, Nachhaltigkeits-Arbeit mit Unternehmen und ihre Arbeit als Autorin greift sie auf geballte Expertise zum Thema zurück.
Janine Steeger bringt über 20 Jahre journalistische Berufserfahrung mit, über fünf Jahre davon moderierte sie bei RTL z.B. die Sendung „Explosiv“. Fachwissen zum Thema Nachhaltigkeit vertiefte sie durch das Studium „Betriebliches Umweltmanagement und Umweltökonomie“. Auch privat hat sie ihr Leben auf Nachhaltigkeit umgestellt: Sie verzichtet weitgehend auf Flüge und Plastik, fährt Fahrrad oder Bahn und setzt auf grüne Mode und Kosmetik.
Fotonachweise: Nadine Dilly
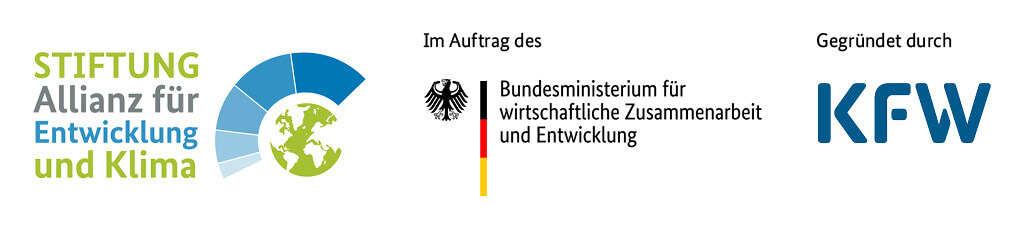
Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima
Chausseestraße 22
10115 Berlin
Telefon: +49 30 3465573-00
E-Mail: info@allianz-entwicklung-klima.de
Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima
Chausseestraße 22
10115 Berlin
Telefon: +49 30 3465573-00
E-Mail: info@allianz-entwicklung-klima.de